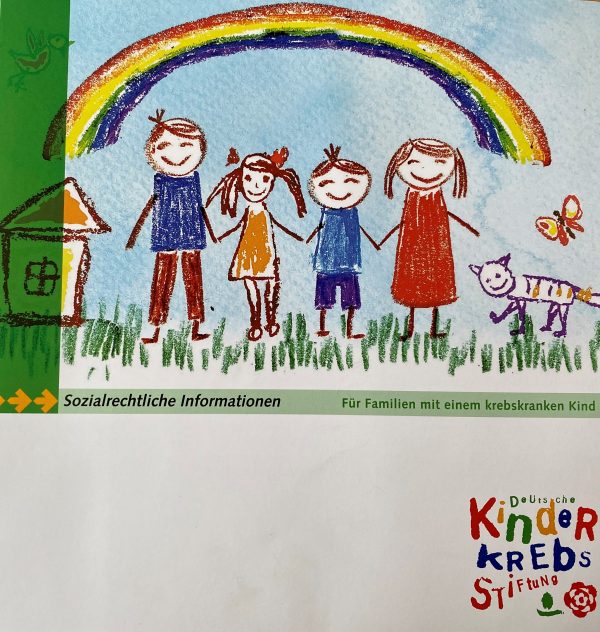Sozialrechtliche, organisatorische und finanzielle Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten in Deutschland
Autor: Ralf Braungart, Barbara Grießmeier, Christina Breuer, Pauline Schuster, Iris Lein-Köhler, Zuletzt geändert: 19.03.2025 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e227360
Inhaltsverzeichnis
Die Behandlung Ihres Kindes bringt viele organisatorische und finanzielle Belastungen für die Familie mit sich, wie beispielsweise häufige Fahrten ins Krankenhaus und/oder doppelte Haushaltsführung bei einer größeren Entfernung zur Klinik. Die Diagnose einer schweren Erkrankung bei Kindern berechtigt nicht automatisch zu bestimmten Leistungen; die Sozialgesetzgebung in Deutschland (verankert im SGB I - XII) ermöglicht aber eine Reihe von Erleichterungen und Unterstützungen, die jeweils einzeln beantragt werden müssen.
Sozialrechtliche Beratung
Die MitarbeiterInnen des Psychosozialen Teams der Klinik werden Sie ausführlich über die Hilfen informieren und Ihnen gegebenenfalls bei der Antragstellung behilflich sein.
Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte auch an Ihre Krankenkasse oder das Versorgungsamt; Kinderkrebsinfo übernimmt keine Haftung für die Aktualität der Darstellung der rechtlichen Ansprüche. (Stand: Febr. 2025)
Pflegebedürftigkeit und Pflegeleistungen
Pflegebedürftigkeit ist keine Frage des Alters: Im Falle der Feststellung eines Pflegegrades haben auch Kinder Anspruch auf sogenannte Pflegeleistungen, wie zum Beispiel das Pflegegeld. Es gibt fünf Pflegegrade, die sich durch das Maß der Selbständigkeit unterscheiden. Entsprechend unterscheiden sich auch die jeweiligen Leistungen der Pflegekasse, einer eigenen organisatorischen Einheit innerhalb der Krankenkassen.
- Ausschlaggebend für die Anerkennung der Pflegebedürftigkeit ist nicht eine bestimmte Erkrankung oder Diagnose, sondern der tatsächliche Pflegeaufwand im Vergleich zu einem gesunden Kind gleichen Alters.
- Die Pflegebedürftigkeit muss längerfristig bestehen, voraussichtlich mindestens 6 Monate.
- Ein Elternteil muss in den letzten zehn Jahren vor der Antragsstellung mindestens zwei Jahre Beiträge zur Krankenversicherung in Deutschland gezahlt haben. Das bedeutet, dass Familien, die beispielsweise erst kurz vor der Diagnosestellung des Kindes nach Deutschland gekommen sind, erst nach 2 Jahren Anspruch auf Pflegeleistungen haben.
- Stellen Sie einen schriftlichen Antrag auf Pflegeleistungen bei der Krankenkasse des Kindes: Antragsformulare lassen sich meist online herunterladen.
- In der Regel wird nach Antragstellung schriftlich ein Hausbesuch durch den MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) angekündigt. In Ausnahmefällen kann die Begutachtung auch nach Aktenlage oder in Form eines strukturierten Telefoninterviews durchgeführt werden. Bei diesem Hausbesuch werden die Selbständigkeit und der zusätzliche Pflegeaufwand Ihres Kindes nach einer standardisierten Methode begutachtet. Die Begutachtung findet auf Deutsch statt; sorgen Sie bei Bedarf für eine Person, die das Gespräch übersetzen kann.
- Wenn Sie verhindert sind (beispielsweise, weil Ihr Kind in der Klinik ist): Sagen Sie den Termin unbedingt rechtzeitig ab und vereinbaren Sie einen neuen. Bitte beachten Sie hierbei, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis der MDK Ihnen einen neuen Termin anbietet.
Tipp: Zur Vorbereitung auf den Hausbesuch empfiehlt es sich, eine Art Tagebuch über mindestens 7 Tage zu führen. Schreiben Sie genau auf, bei welchen Aktivitäten Sie Ihr Kind unterstützen und/oder anleiten müssen, sowohl tagsüber als auch nachts.
Zentraler Maßstab der Begutachtung ist der Grad der Selbständigkeit Ihres Kindes und das Angewiesen-Sein auf personelle Unterstützung. Hierzu werden 6 Lebensbereiche (Module) erfasst: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen, sowie Gestaltung des Arbeits- und Alltagslebens. Zusätzlich werden auch die Bereiche „Außerhäusliche Aktivitäten“ und „Haushaltsführung“ berücksichtigt.
In jedem Modul werden Punkte vergeben und zusammengezählt. Beim Gesamtpunktwert werden die Bereiche unterschiedlich gewichtet; die vergebene Gesamtpunktzahl entscheidet über die Pflegebedürftigkeit und den Pflegegrad.
- Der Pflegegrad wird durch einen Vergleich der Beeinträchtigungen ihrer Selbständigkeit und ihrer Fähigkeitsstörungen mit altersentsprechend entwickelten Kindern ermittelt.
- Für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensmonats werden lediglich die Module 3, 4 und 5 gewertet.
- Bei diesen Kindern wird zusätzlich festgestellt, ob es gravierende Probleme bei der Nahrungsaufnahme gibt.
- Kleinkinder bis zu 18 Monaten werden automatisch einen Grad höher eingestuft als ältere Kinder und Erwachsene.
- Die Höhe der jeweiligen Pflegeleistungen richtet sich nach dem festgestellten Pflegegrad. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Höhe der Pflegeleistungen bei Ihrer Pflegekasse.
- Sie haben die Wahl zwischen Pflegesachleistungen (durch professionelle Kräfte eines ambulanten Pflegedienstes) und Pflegegeld (für die Pflege durch Familienangehörige/Eltern oder eigenbeschaffte Pflegekräfte).
- Sie können diese Leistungen auch beliebig miteinander kombinieren (Kombinationsleistung).
- Der sogenannte Entlastungsbetrag wird nicht ausgezahlt. Das Geld kann beispielsweise für die Unterstützung im Haushalt (haushaltsnahe Dienstleistungen) verwendet werden. Entsprechende Dienstleister rechnen dann direkt mit der Krankenkasse ab.
- Zusätzlich stehen Ihnen 42 € im Monat für Pflegehilfsmittel (z.B. Handschuhe, Händedesinfektionsmittel, Mundschutz etc.) zu.
- Wenn Sie selbst als Pflegeperson stunden– oder tageweise eine Vertretung brauchen, können Sie Verhinderungspflege beantragen. Das Geld können Sie an eine Person Ihrer Wahl auszahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Pflegegrad von 2 oder 3 bereits seit sechs Monaten besteht. Liegt ein Pflegegrad 4 oder 5 vor und hat ihr Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet, können Sie die Leistung sofort in Anspruch nehmen.
- Wird Ihr Kind unerwartet zum Pflegefall, hat ein berufstätiger Angehöriger Anspruch auf kurzzeitige Freistellung von der Arbeit für bis zu 10 Tagen pro Jahr, um eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren. Sie bekommen in dieser Zeit ein Pflegeunterstützungsgeld analog dem Kinderkrankengeld in Höhe von 90 % des Nettoeinkommens. Dieser Anspruch besteht nur, wenn kein Anspruch auf Krankengeld bei Erkrankung des Kindes besteht.
- Wenn Ihr Arbeitgeber über mindestens 15 Beschäftigte verfügt, können Sie Pflegezeit in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um eine unbezahlte Freistellung für längstens 6 Monate. Hinweis: Ihr Versicherungsstatus muss mit der eigenen Krankenkasse besprochen werden. In dieser Zeit haben Sie Anspruch auf ein zinsloses Darlehen. Dieses können Sie beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen.
- Wenn Ihr Arbeitgeber über mindestens 25 Beschäftigte verfügt, können Sie Familienpflegezeit für längstens 24 Monate beantragen. Sie müssen in dieser Zeit jedoch mindestens 15 Wochenstunden arbeiten. Auch hier haben Sie Anspruch auf ein zinsloses Darlehen.
- Nutzen Sie auf jeden Fall Ihr Recht auf umfangreiche Beratung durch Ihre Krankenkasse.
Schwerbehindertenausweis
Wenn Ihr Kind an einer bösartigen Erkrankung leidet, hat es in der Regel Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis, der bei Kindern grundsätzlich befristet ausgestellt wird. Manche Eltern befürchten, dass das Ansehen ihres Kindes in der Öffentlichkeit leiden könne, wenn es als „behindert“ gilt und verzichten auf die Beantragung eines solchen Ausweises. Dabei bedeutet ein Schwerbehindertenausweis, dass Eltern und Kind Vorteile genießen können (wie beispielsweise ermäßigte Eintritte in öffentlichen Einrichtungen), so dass Nachteile wegen der Behinderung ausgeglichen werden (Nachteilsausgleich).
Grundlagen
- Als behindert gelten Menschen, wenn ihre körperlichen Funktionen, geistigen Fähigkeiten oder seelische Gesundheit länger als sechs Monate von einem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist.
- Den Antrag können Sie bei Ihrem zuständigen Landratsamt/Versorgungsamt stellen. Legen Sie nach Möglichkeit Arztberichte oder medizinische Befunde bei, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Diese ist leider sehr lang und liegt in der Regel zwischen 3 und 7 Monaten.
- Das Amt bestimmt den Grad der Behinderung (GdB). Dieser wird in Stufen zwischen 10 und 100 ausgedrückt.
- Zusätzlich werden sogenannte gesundheitliche Merkmale anerkannt, die auch als Merkzeichen bezeichnet werden.
Merkzeichen
Der Grad der Behinderung und die Merkzeichen sind die Grundlage dafür, welche Nachteilsausgleiche Ihr Kind mit dem Schwerbehindertenausweis in Anspruch nehmen kann.
Das Merkzeichen „G“ steht Menschen zu, die in der Bewegungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sind und dadurch nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten (oder nicht ohne Gefahren für sich und/oder andere) Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen können, die üblicherweise zu Fuß zurückgelegt werden (etwa 2 km in etwa einer halben Stunde).
Als Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind solche Personen anzusehen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb eines Kraftfahrzeugs bewegen können.
- Ständig hilflos sind Personen, die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Umfang ständig fremder Hilfe bedürfen..
- Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten.
- Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind insbesondere An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft.
- Unabhängig davon ist Hilflosigkeit auch dann gegeben, wenn Hilfe zwar nicht ständig geleistet wird, jedoch der Hilfeleistende in dauernder Bereitschaft sein muss.
- Bei Kindern mit malignen Erkrankungen ist Hilflosigkeit für die Dauer der zytostatischen Intensiv-Therapie anzunehmen.
Ständige Begleitung ist bei Schwerbehinderten notwendig, die infolge ihrer Behinderung zur Vermeidung von Gefahren für sich oder andere bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln regelmäßig auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen rund um den Schwerbehindertenausweis auch an den psychosozialen Dienst Ihrer Klinik.
Integrations- und Versorgungsämter verschicken auf Wunsch kostenlose Broschüren.
Eine sehr gute Übersicht gibt diese Broschüre der Hamburger Sozialbehörde:
Leistungen der Krankenkasse
Grundsätzlich übernimmt die Krankenkasse sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Behandlung Ihres Kindes stehen; einige Besonderheiten müssen dabei beachtet werden. Die MitarbeiterInnen des psychosozialen Dienstes helfen Ihnen gerne bei Fragen und Problemen – insbesondere deshalb, weil diese Leistungen teilweise nur von den gesetzlichen Kassen übernommen werden.
- Grundsätzlich wird bei allen Leistungen wie z. B. Fahrkostenerstattung, Heilmitteln oder Physiotherapie eine Zuzahlung von 10 % der Kosten erhoben; mindestens 5 € und höchstens 10 €.
- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von allen Zuzahlungen befreit – Ausnahme sind: Fahrkosten, Zahnersatz und kieferorthopädische Behandlung.
- Die maximale Höhe der Zuzahlungen pro Jahr ist für jede Haushaltsgemeinschaft jedoch begrenzt. In der Regel gelten 2 % des Familienbruttoeinkommens als Belastungsgrenze, abzüglich bestimmter Freibeträge für Ehepartner und Kinder.
- Sobald ein Familienmitglied chronisch krank ist, müssen Zuzahlungen nur noch in Höhe von 1 % der jährlichen Bruttoeinnahmen geleistet werden.
Als „chronisch krank“ gilt,
- wer wegen derselben Erkrankung über 12 Monate mindestens einmal pro Quartal in ärztlicher Behandlung ist,
- mindestens Pflegegrad 3 hat,
- mindestens 60 % schwerbehindert ist,
- eine kontinuierliche medizinische Versorgung benötigt, ohne die eine lebensbedrohliche Verschlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität zu erwarten ist.
Tipps zum Thema "Zuzahlung"
- Berechnen Sie Ihre persönliche Belastungsgrenze mit Hilfe des „Zuzahlungsrechners“ Ihrer Krankenkasse.
- Wenn Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, bitten Sie die Ärztin/ den Arzt um die Ausstellung einer „Chronikerbescheinigung“ (Muster 55).
- Wenn Sie Ihre Belastungsgrenze erreicht haben, können Sie einen Antrag auf Befreiung von Zuzahlungen stellen.
Bestehen Sie auf mit Ihrem Namen versehene Zuzahlungsbelege. Verwahren Sie diese sorgfältig und legen Sie die gesammelten Belege für das laufende Jahr der Krankenkasse vor.
- Die Krankenkasse übernimmt Fahrkosten bei chemotherapeutischer oder strahlentherapeutischer Behandlung Ihres Kindes, wenn diese Fahrten medizinisch zwingend notwendig sind und vom Arzt verordnet wurden.
- Bitten Sie um die Ausstellung einer „Verordnung von Krankenfahrten“.
- Wenn Sie die Genehmigung der Krankenkasse einem Taxiunternehmen vorlegen, wird dieses entstehende Kosten (nach Abzug der Zuzahlung, die Sie selbst übernehmen müssen) direkt mit der Krankenkasse abrechnen.
- Wenn Sie mit dem eigenen PKW fahren, stellen Sie einen Antrag auf Erstattung von Fahrkosten. Die Krankenkasse übernimmt einen bestimmten Betrag pro Kilometer – ebenfalls nach Abzug der Zuzahlung.
- Fahrten zur ambulanten Behandlung im Rahmen der Gesamtbehandlung Ihres Kindes sollten in der Regel übernommen werden. Hier gibt es jedoch immer wieder Klärungsbedarf mit einigen Kassen. Holen Sie sich in diesen Fällen Hilfe bei Ihrem Psychosozialen Dienst.
Wenn Sie und Ihre Tochter/Ihr Sohn gesetzlich versichert sind, haben Sie Anspruch auf Kinderkrankengeld, wenn
- nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass Sie zur Beaufsichtigung, Betreuung und Pflege Ihres kranken Kindes der Arbeit fern und zu Hause bleiben müssen,
- eine andere in Ihrem Haushalt lebende Person dies nicht übernehmen kann,
- Ihr Kind das 12. Lebensjahr noch nicht erreicht hat oder einen Schwerbehindertenausweis besitzt. Dieser begründet, dass diese Regelung auch über das 12. Lebensjahr hinaus gilt (Kinderkrankengeld ohne Altersbegrenzung).
Dauer und Höhe des Anspruchs
- Der Anspruch besteht jährlich für bis zu 15 Tage für jedes Kind, jedoch maximal für 35 Tage (selbst bei 3 und mehr Kindern).
- Wenn beide Eltern arbeiten, hat jeder Anspruch auf 15 Tage.
- Bei Alleinerziehenden verdoppelt sich der Anspruch auf 30 Tage und insgesamt maximal 70 Tage.
- Das Kinderkrankengeld beträgt 90 bzw. 100 % des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts.
- Der Arbeitgeber muss den betreffenden Arbeitnehmer freistellen.
Wenn Sie bei einer stationären Behandlung Ihres Kindes aus medizinischen Gründen als Begleitperson mitaufgenommen werden, können Sie Kinderkrankenpflegegeld nach §45 Abs. 1a SGB V beantragen.
Voraussetzung dafür ist, dass das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Das Kinderkrankenpflegegeld beträgt 90 bis 100 % des ausgefallenen Nettoarbeitsentgeltes. Der Anspruch besteht so lange, wie die stationäre Mitaufnahme des Elternteils andauert und wird nicht von den oben genannten Kind-krank-Tagen abgezogen.
Sind Kinder schwer und unheilbar erkrankt, greift das „Gesetz zur Sicherung der Betreuung und Pflege schwerstkranker Kinder“ (§45 Abs. 4 SGB V).
Sie haben dann als berufstätiger Elternteil einen zeitlich unbegrenzten Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit, wenn das Kind an einer Krankheit leidet,
- die progredient verläuft und bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat,
- bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung notwendig oder von einem Elternteil erwünscht ist und
- die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt.
In diesen Fällen bezahlt die Krankenkasse des Kindes einem Elternteil unbegrenztes Kinderpflegekrankengeld.
Dies ist auch möglich, wenn der andere Elternteil des Kindes nicht berufstätig ist und das Kind ansonsten versorgt. Auch hier gilt, dass die Leistung über das 12. Lebensjahr hinaus gewährt werden kann, wenn das Kind behindert ist. Suchen Sie das Gespräch mit den ÄrztInnen Ihres Kindes und lassen Sie sich eine entsprechende Bescheinigung ausstellen.
Zur Betreuung von Geschwistern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen. Voraussetzung ist, dass sich das erkrankte Kind in stationärer Behandlung befindet, die Mitaufnahme eines Elternteils medizinisch notwendig ist und der andere Elternteil wegen der Berufstätigkeit abwesend ist. Bei einigen Kassen liegt die Altersgrenze bei 14 Jahren. In manchen Fällen kann dies auch bei teilstationärer Behandlung genehmigt werden, wenn die Behandlung fast den ganzen Tag dauert.
- Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe, die nicht bis zum 2. Grad mit Ihnen verwandt oder verschwägert ist. Für Verwandte bis zum 2. Grad können die erforderlichen Fahrkosten und ein eventueller Verdienstausfall übernommen werden. (Verwandte 2. Grades)
- Auch ein Elternteil kann unbezahlten Urlaub nehmen und sich den entstandenen Verdienstausfall von der Krankenkasse erstatten lassen.
- Eine Haushaltshilfe kann auch über die Krankenkasse vermittelt werden.
- Je nach Kassensatzung werden unterschiedliche Stundenlöhne vergütet. Pro Tag ist eine Zuzahlung von 10 % der Kosten zu leisten, mindestens 5 €, jedoch höchstens 10 €.
- Haushaltshilfe wird für maximal 8 Stunden/Tag gewährt – allerdings nur für die Stunden, in denen die Kinder nicht anderweitig (wie Schule oder Kita) betreut sind.
Reichen diese Leistungen nicht aus oder werden sie abgelehnt, können Sie „Leistungen zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen“ beim Jugendamt beantragen (§20 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe).
Wenn Sie berufstätig sind, werden Sie sich fragen, wie Sie die Dreifachbelastung – Arbeit, Familie und Krankheit – bewältigen sollen. Viele Eltern machen sich Sorgen, vielleicht ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Insbesondere für Familien mit einem eher geringen Einkommen kann ein möglicher Lohnausfall schnell zu einem finanziellen Engpass führen. In Deutschland gibt es keine allgemeine rechtliche Möglichkeit der längerfristigen Freistellung vom Arbeitsplatz, wenn ein Kind schwer erkrankt - es müssen individuelle Lösungen gefunden werden.
Insbesondere direkt nach der Diagnosemitteilung sind die meisten Eltern zunächst nicht arbeitsfähig. Möglicherweise könnten Sie sich nicht voll auf die Arbeit konzentrieren, würden Fehler machen und eventuell (je nach Branche) sogar andere Menschen gefährden. Sprechen Sie offen mit Ihrem Hausarzt, der Ihnen möglicherweise eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen wird. Dadurch gewinnen Sie Zeit, in der Sie nichts überstürzt entscheiden müssen und sich erst einmal sammeln können.
Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber: Nennen Sie die Diagnose Ihres Kindes und wenn möglich informieren Sie ihn auch über die geplante Therapie und die Behandlungsdauer.
Der offene Umgang mit der Erkrankung fördert in vielen Fällen auch bei Ihrem Arbeitgeber Verständnis und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten der Unterstützung:
- Zusage zum Erhalt des Arbeitsplatzes
- Flexibler Umgang mit dem Wiedereinstieg
- Aufstockung des Krankengeldes durch den Betrieb
- Akzeptanz einer längeren Arbeitsunfähigkeit
- Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen
- Umstellung von Wechselschicht auf Normalschicht
- Reduzierung der Arbeitszeit
- Home-Office
Wenn Sie eine unbezahlte, sozialversicherte Freistellung von der Arbeit für 6 Monate im Rahmen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen, bleibt Ihr Arbeitsplatz erhalten.
Wenn Sie Familienpflegezeit beantragen, haben Sie von 12 Wochen vor dem Beginn der Familienpflegezeit bis zum Ende der Familienpflegezeit Kündigungsschutz.
Sollten Sie durch Lohneinbußen in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sprechen Sie mit Ihrem Psychosozialen Dienst über Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung durch Sozialfonds oder die Elterninitiativen.
Auch wenn sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Behandlung Ihres Kindes entstehen, von den Krankenkassen übernommen werden, können durch eine Krebserkrankung auch vorübergehende finanzielle Belastungen entstehen. Gründe hierfür können zeitweise Lohneinbußen sein, aber auch Ausgaben für Geschenke, Lieblingsspeisen und Sonderwünsche der Kinder. Die Erstattung von Fahrkosten oder Ausgaben für eine selbstbeschaffte Haushaltshilfe kann einige Wochen dauern, steuerliche Erleichterungen greifen erst im nächsten Jahr.
Voraussetzung für die Gewährung von finanziellen Hilfen ist, dass Sie die durch die Krankheit entstehenden besonderen Kosten nicht aus eigener Kraft bestreiten können.
Mögliche Anlaufstellen für finanzielle Zuschüsse könnten sein:
- Sozialfonds der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe – Aktion für krebskranke Kinder e.V., Dachverband www.kinderkrebsstiftung.de/sozialfonds.html
- Härtefonds der Deutschen Krebshilfe e.V. www.krebshilfe.de/haertefonds.html
Von diesen Organisationen können Sie bei Vorliegen nachgewiesener Bedürftigkeit jeweils eine einmalige Unterstützung erhalten, die nach §84 SGB XII bzw. §11 Abs. 4 SGB II nicht auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende oder der Sozialhilfe angerechnet werden darf.
Bei Antragsstellung müssen die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die festen Ausgaben der Familie offengelegt werden.
Manche Elterngruppen oder Fördervereine vor Ort gewähren ebenfalls finanzielle Zuschüsse.
In allen Fragen rund um dieses Thema beraten Sie die MitarbeiterInnen der Psychosozialen Dienste.

 Deutsche Kinderkrebsstiftung. Broschüre, Auflage 2021: Sozialrechtliche Grundlagen (1.3 MB)
Deutsche Kinderkrebsstiftung. Broschüre, Auflage 2021: Sozialrechtliche Grundlagen (1.3 MB)